Rückläufige Fallzahlen in offiziellen Statistiken werden oft von Politikern verwendet, um den Bürgern ein Gefühl von erhöhter Sicherheit zu vermitteln. Häufig weichen jedoch Sicherheitsgefühl und Risikowahrnehmung der Bürger von amtlichen und wissenschaftlichen Feststellungen ab. Im Zentrum der diesjährigen Veranstaltung „Transformation als Chance VI“ sollte daher die Frage nach dem Auseinanderfallen von subjektiver Risikowahrnehmung und der „tatsächlich vorhandenen“ Bedrohungslage stehen.
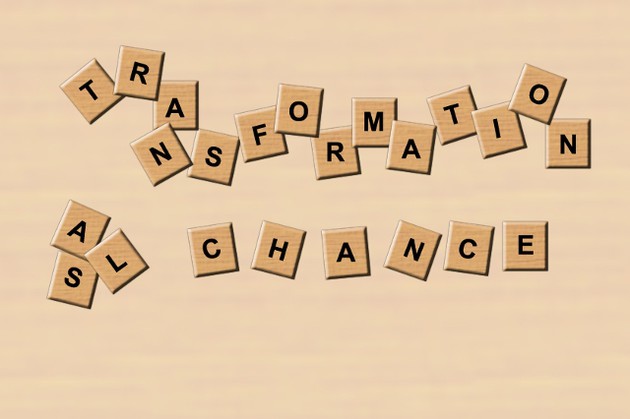
Transformation als Chance
Quelle: Bundesakademie für Sicherheitspolitik
Auch in diesem Jahr konnte die BAKS hochrangige Referenten aus der Wissenschaft, den Medien und der Politik für die Veranstaltung gewinnen. Prof. Dr. Hans Peter Peters vom Forschungszentrum Jülich erläuterte in seinem Eingangsstatement zunächst den Begriff „Risiko“ näher. Risiken haben immer einen Entscheidungsbezug: Wie weit setzt man sich oder andere einem Risiko aus? Wie kann man Risiken regulieren? - Eine wichtige Rolle kommt dabei vor allem den Medien zu, die in der Risikokommunikation nicht nur als Informationslieferant dienen, sondern auch Handlungsempfehlungen auf persönlicher sowie politisch-gesellschaftlicher Ebene geben. Darüber hinaus haben Medien eine meinungsbildende Funktion und sind ein Forum für die Problembearbeitung in der Öffentlichkeit. Medien orientieren sich bei ihrer Themenauswahl nicht an der statistischen Risikohöhe, sondern am Nachrichtenfaktor. Auffällig ist, dass negative Berichterstattung in der Bevölkerung bevorzugt wahrgenommen wird. Medien haben auch Auswirkungen auf den politischen Prozess: Mediale Resonanz wird als Relevanzindikator gesehen. Politik und Behörden schließen häufig an medial kommunizierte Ereignisse an.
Die bedeutende Funktion der Medien bestätigte auch Dr. Gaby-Fleur Böl vom Bundesinstitut für Risikobewertung in ihrem anschließenden Vortrag, indem sie anhand von vier Gesundheitsrisiken aufzeigte, dass etwa 90% der Befragten Informationen diesbezüglich durch die Medien erhalten hatten. Für die Risikowahrnehmung und Akzeptanz in der Bevölkerung sind dabei Faktoren wie Kontrollierbarkeit, Freiwilligkeit oder persönliche Betroffenheit von großer Bedeutung. Außerdem erläuterte sie die Rolle von Vertrauen in die Informationsquellen, wobei laut einer Befragung Verbraucherorganisationen und Wissenschaftler das höchste, Regierungsvertreter dagegen das geringste Vertrauen der Bevölkerung genießen. Bei diesem Vortrag stand die Frage im Mittelpunkt, wie Risikokommunikation gestaltet werden muss, um Informationen objektiv zu vermitteln ohne Panik zu schüren. Dazu riet sie, „mehrdimensional, partizipativ, transparent, proaktiv“ zu kommunizieren und verschiedene Interessensgruppen und gesellschaftliche Multiplikatoren wie Ärzte oder Lehrer in die Risikokommunikation mit einzubinden.
Die Paneldiskussion mit der Bundestagsabgeordneten Elke Hoff, dem Minister für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen Armin Laschet und dem Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes Heinz Fromm beleuchtete die Risiken, die mit der Migration, der Integration, des Terrorismus sowie des Rechtsextremismus wahrgenommen werden.
Bei der weiteren Debatte wurde deutlich, dass gefühlte und tatsächliche Bedrohung zusammen gedacht werden müssen. Die Berücksichtigung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung ist deswegen ebenso wichtig wie die Verbesserung der Sicherheitslage. Im Bereich der Innen- und Außenpolitik geht jedoch die „gefühlte“ Sicherheit in Deutschland oft an den tatsächlichen Problemen vorbei. Hilfreich bei der Risikokommunikation sind das Eingehen auf mögliche Befürchtungen und Ängste, der Aufbau von konstruktivem Dissens und die Schaffung von größtmöglicher Transparenz.
Vier Gesprächsgruppen mit Experten zu den Themen Katastrophen, Rechtsextremismus, Finanzmarktkrise und Verbraucherschutz machten deutlich, dass Risikokommunikation immer auch antizipierte Krisenkommunikation ist. Konsens bestand darin, dass Behörden und offizielle Institutionen gut daran tun, proaktiv und partizipativ tätig zu werden, d.h. Themen schon zu besetzen und auch mit zivilgesellschaftlichen Gruppen zu diskutieren, wenn sie noch nicht im Fokus des allgemeinen Interesses stehen. Ziel der Risikokommunikation ist die Bewusstseinsbildung der Bevölkerung für eine Krise.
Auch bei der zweiten Podiumsdiskussion mit Prof. Dr. Martin Löffelholz von der TU Ilmenau, Olaf Bandt vom BUND und dem Sprecher des Berliner Senats, Dr. Richard Meng, stand die Risikokommunikation im Mittelpunkt. Hier wurde abermals sichtbar, dass Risikokommunikation immer interessengeleitet ist, auch im wissenschaftlichen Raum. Die Frage, welche Risiken wie transportiert werden, ist immer eine Frage der dahinter stehenden Prioritäten. Risikokommunikation kann sich daher auf dem gesamten Spektrum zwischen Verharmlosung und Panikmache abbilden. Auch erschwert die fachliche Komplexität eines Problems häufig die sachgerechte Darstellung von Risiken in den Medien.
Die engagierten und fundierten Beiträge von Referenten und Teilnehmern ermöglichten, dass abermals ein konstruktiver, ergebnisreicher interdisziplinärer Erfahrungsaustausch an der BAKS stattfand.
Autor: Christine Meissler und Ursula Blanke
