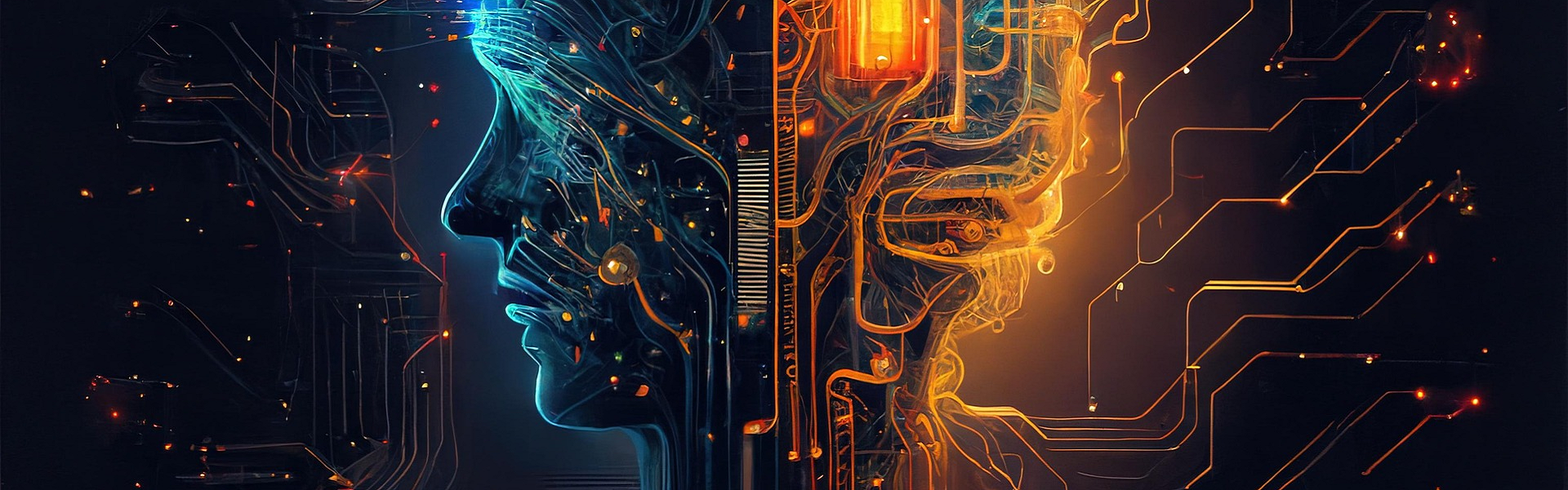Zwei Szenarien für das Jahr 2035 – Künstliche Intelligenz in der Sicherheitspolitik
Im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz (KI) steht Deutschland am Scheideweg: Entweder in Richtung der Abhängigkeit und Verwundbarkeit oder in Richtung digitaler Souveränität und Wehrhaftigkeit. Für das Jahr 2035 sind beide Szenarien denkbar. Wenn die strategische Umsetzung von KI in sicherheitspolitisch zentralen Bereichen ausbleibt, könnte Deutschland an Verteidigungs- und Krisenreaktionsfähigkeit verlieren. Setzt es hingegen auf Innovation, kann KI zum Treiber einer sicherheitspolitischen Zeitenwende werden. Foto: Pixabay/Kohji Asakawa
Szenario: Deutschland gestaltet gemeinsame Innovationsräume
Deutschland im Jahr 2035: ein Staat, der auf Freiräume, Marktdynamik und technologieoffene Kooperationsstrukturen setzt. Der Kurswechsel begann mit dem politischen Willen, KI nicht länger nur zu verwalten, sondern durch gezielte Investitionen, Deregulierung und pragmatische Beschaffungsverfahren zu ermöglichen. Dialogplattformen zwischen Staat, Wirtschaft und Forschung ermöglichten Innovationsökosysteme für technologischen Fortschritt. In „KI-Sicherheitskorridoren“ entwickelten Unternehmen, Bundeswehr und Behörden gemeinsam Prototypen. Diese Innovationsräume verbanden klare Leitplanken mit niedrigen Markteintrittsbarrieren und entwickelten sich zum Erfolgsmodell, das Skalierung ermöglichte.
Ein zweiter Wendepunkt war die Entscheidung, sich nicht länger allein auf Basismodelle aus Drittstaaten zu verlassen. Deutschland unterstützte den Aufbau europäischer Sprachmodelle, investierte aber zugleich in offene, nachvollziehbare Systeme mit Fokus auf Erklärbarkeit. Die Einsicht setzte sich durch, dass Souveränität nicht allein durch Eigenentwicklung entsteht, sondern durch Transparenz, Auditierbarkeit und strategische Unabhängigkeit.
KI wurde zum zentralen Treiber eines Paradigmenwechsels im Militär: weg von plattformzentrierter Planung hin zu Software Defined Defense. Echtzeitlagebilder, simulationsgestützte Entscheidungsunterstützung und adaptive Agentensysteme führten zu operativer Effektivität. Das entlastete die Einsatzkräfte, die angesichts des Fachkräftemangels eine wertvolle Ressource waren und erhöhte die Reaktionsfähigkeit bei gleichzeitiger menschlicher Kontrolle.
Bereits 2025 zeigten Bitkom-Daten eine tiefe Skepsis gegenüber Blackbox-Systemen. In Deutschland förderte man das Vertrauen der Bevölkerung in KI, indem man konsequent auf Nachvollziehbarkeit sowie menschliche Aufsicht setzte. Zehn Jahre später sind transparente und wirksame KI-Anwendungen fest in Verwaltung und Sicherheitsarchitektur integriert. 2035 ist Deutschland zwar kein globaler Technologieführer geworden, aber im Rahmen der EU ein souveräner Akteur mit belastbaren Partnerschaften, funktionierender digitaler Infrastruktur und einem Selbstverständnis, in dem Sicherheit nicht gegen Innovation steht.
Szenario: Deutschland handelt nicht und verliert den Anschluss
Im Jahr 2035 ist die Bundesrepublik sicherheitspolitisch in eine Lage geraten, die sich bereits ein Jahrzehnt zuvor abzeichnete. Deutschland hatte sich ambitionierte Ziele in der Digitalpolitik gesetzt, es jedoch versäumt, diese konsequent umzusetzen. Während geopolitische Konkurrenten KI-gestützte Systeme entwickelten und ihre sicherheitspolitischen Strategien und militärischen Einsatzgrundsätze darauf ausrichteten, führte die fragmentierte Digitalisierungslandschaft im öffentlichen Sektor und der Bundeswehr dazu, dass Deutschland in vielen Bereichen den technologischen Anschluss verlor.
Die Debatte über die Rolle künstlicher Intelligenz in der Sicherheitspolitik wurde zwar geführt, doch wie beim Thema bewaffnete Drohnen blieben Entscheidungen aus. Der Digitalverband Bitkom verwies 2024 auf gravierende Lücken bei der Umsetzung der digitalen Transformation. Zur gleichen Zeit hielten auch schon 72 Porzent der Unternehmen die Herkunft von KI-Produkten für sicherheitsrelevant. Doch lange änderte sich hier wenig. Der Aufbau einer souveränen KI-Infrastruktur wurde zwar angestoßen, konnte jedoch mangels strategischer Skalierungsmechanismen nicht die notwendige Wirkung entfalten. Obwohl eine Mehrheit der Organisationen KI als strategisches Zukunftsfeld einstufte, blieb es bei isolierten Einzelinitiativen.
Deutschland förderte nicht ausreichend seine eigene digitale Souveränität und wurde verwundbarer für Cyberangriffe, ohne über wirksame Reaktionsstrukturen zu verfügen. Startups, die nationale KI-Lösungen entwickeln wollten, konnten sich aufgrund von fehlenden Aufträgen und regulatorischen Hürden nicht am Markt etablieren. Auch europäische Initiativen zur digitalen Souveränität scheiterten an zersplitterten Zuständigkeiten und einer innovationshemmenden Förderlogik.
2032 kam es erstmals zu großflächigen Störungen kritischer Infrastrukturen: Verkehrsleitsysteme, Notfallnetze und Kommunikation fielen aus, ausgelöst durch feindliche autonome KI-Agenten, denen deutsche Stellen nichts entgegensetzen konnten. Frühwarnsysteme, automatisierte Response-Mechanismen und zivil-militärische Kooperationsformate und Einsatzpläne existierten auf dem Papier, aber wurden nie geübt und konnten daher nicht in der Praxis umgesetzt werden.
Die Bundeswehr verfügte über keine einsatzfähigen KI-Systeme unter nationaler Kontrolle. In vielen Bereichen blieb Verwaltungs-KI intransparent. Insbesondere dort, wo Projekte nicht wie geplant Wirkung entfalten konnten, nahm das Vertrauen in die digitale Steuerungsfähigkeit staatlicher Institutionen spürbar ab. Deutschland gilt 2035 als technologisch zurückgefallene Industrienation, deren Fokus auf Konsens und Risikovermeidung zu einem Verlust sicherheitspolitischer Handlungsfähigkeit geführt hat.
Das Denken in Szenarien zählt zum täglichen Handwerkszeug von Führungskräften in Politik, Behörden, Wirtschaft und Zivilgesellschaft – und zu den Methoden der Strategischen Vorausschau, wie sie die BAKS vermittelt. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Arbeitskreises Junge Sicherheitspolitik haben wir zehn AKJS-Angehörige gebeten, zehn Jahre in die Zukunft zu blicken und zwei Szenarien zu entwerfen: Was wäre der sicherheitspolitische worst case? Und wie soll sich Deutschland stattdessen aufstellen, um als freiheitliche Demokratie in einem sicheren Europa zu bestehen? Ihre Einschätzungen und Empfehlungen erscheinen hier in loser Folge.