
In Genf befindet der zweite Hauptsitz der Vereinten Nationen. Hier ein Blick in den Menschenrechtssaal im Palais des Nations. Foto: UN Photo/Pierre Albouy
Strategisches Denken in der Sicherheitspolitik erfordert heute mehr denn je einen integrierten Ansatz, der traditionelle Grenzen zwischen innerer und äußerer Sicherheit sowie zwischen den verschiedenen tradierten Politikfeldern überwindet. Genf als ein Zentrum der multilateralen Diplomatie bot dem Arbeitskreis Junge Sicherheitspolitik (AKJS) vom 16. bis 17. Juni 2025 eine einzigartige Gelegenheit, dieses Jahresthema aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. In einer Zeit, in der Pandemien, Klimawandel, hybride Angriffe und die Erosion des Multilateralismus die globale Sicherheitslandschaft prägen, zeigten die Gespräche eindrucksvoll, wie integrierte Sicherheit als strategische Antwort auf komplexe Herausforderungen verstanden werden muss.
Schweizer Sicherheitspolitik: Neutralität und strategische Neuausrichtung
Die Schweiz verkörpert exemplarisch, wie strategisches Denken nationale Traditionen mit neuen Realitäten verbinden muss. Die Gespräche des Arbeitskreises mit dem Geneva Center for Security Policy (GCSP) und dem Think Tank FORAUS zeigten, wie sich die Alpenrepublik derzeit in einem Paradigmenwechsel befindet: von einer auf territoriale Verteidigung ausgerichteten Neutralitätsarmee hin zu einer Streitkraft, die auch hybride Angriffe abwehren kann. Besonders bemerkenswert war, dass die Schweiz mittlerweile drei von vier militärischen Szenarien einer Landesverteidigung im hybriden Spektrum annimmt. Neben einer Erhöhung der Verteidigungsausgaben setzen die Eidgenossen auf ein Konzept der „Erweiterten Verteidigung,“ das zivile und militärische Komponenten verzahnt.
Die Neutralitätsdebatte zeigt ebenfalls, wie integrierte Sicherheit strategisches Umdenken erfordert. Die junge Generation von Schweizer Sicherheitspolitikern sieht Neutralität weniger als Selbstzweck, sondern als sicherheitspolitisches Instrument. Während die juristische Neutralität beibehalten werden soll, steht die politische Neutralität zur Disposition – eine Differenzierung, die strategisches Denken zwischen verschiedenen Politikfeldern ermöglicht.
Multilateralismus unter Druck: Strategische Anpassung in der WHO

Der Besuch bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verdeutlichte dramatisch, wie sich internationale Organisationen strategisch anpassen müssen, um in einer multipolaren Welt zu bestehen. Der angekündigte WHO-Austritt der USA führt zu drastischen Budgetkürzungen und zwingt die Organisation zu einer Prüfung neuer Finanzierungsmodelle und Partnerschaften - während sie zugleichh ihre Unabhängigkeit zu wahren hat.
Auch die sicherheitspolitische Dimension globaler Gesundheitspolitik wurde deutlich: Pandemien sind längst als Sicherheitsbedrohungen anerkannt, die koordinierte Antworten über Sektorgrenzen hinweg erfordern. Auch die Sender-Empfänger-Logik des Individuums zeichnete sich dabei ab: Der Mensch ist nicht nur passiver Empfänger von Gesundheitssicherheit, sondern auch aktiv gefordert – durch präventives Verhalten, Teilnahme an Gesundheitssystemen und als Informationsquelle für Frühwarnsysteme. Dies spiegelt sich in der WHO-Abteilung für Public Health Intelligence, die Früherkennung, Risikoanalyse und präventive Maßnahmen miteinander verbindet.
Humanitäres Völkerrecht: Integrierte Ansätze in Konfliktgebieten
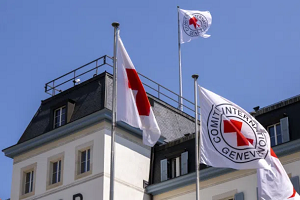
Der Besuch beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) zeigte, dass auch humanitäre Hilfe strategisches Denken erfordert. So muss das IKRK in Konfliktlagen planen, welche Parteien wie überzeugt werden können, wie Neutralität gewahrt bleibt, welche Sicherheitsrisiken bestehen und wie andere humanitäre Akteure eingebunden werden können. Humanitäre Hilfe ist zwar oft kurzfristig erforderlich - sie wirksam einzubringen setzt jedoch ein hohes Maß an strategischer Planung und das Zusammenwirken mit anderen humanitären, diplomatischen und oft auch militärischen Instrumenten voraus.
Welthandel und Wirtschaft: Handelspolitik als Sicherheitspolitik
Die Gespräche bei der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) verdeutlichten, wie Handelspolitik zunehmend als Instrument der Sicherheitspolitik verstanden werden muss. US-Präsident Donald Trumps angekündigte Zollpolitik bedroht nicht nur den Multilateralismus, sondern zeigt auch, wie wirtschaftliche Instrumente strategisch für geopolitische Ziele eingesetzt werden. Die Welthandelsorganisation (WTO) steht derweil unter enormem Druck, während auch kleine und mittlere Staaten weiterhin ein vitales Interesse an regelbasiertem Handel haben – sie könnten in bilateralen Zollkonflikten nicht bestehen. Des Weiteren drehten sich die Gespräche um die Überwachung menschenrechtlicher Standards in Lieferketten durch Unternehmen, etwa durch Kontrollen bei Zulieferern oder Beschwerdemechanismen für Arbeiterinnen und Arbeiter.
Klima und Migration: Integrierte Antworten auf globale Herausforderungen
Auch der Klimawandel kam in den Diskussionen des Arbeitskreises bei den Genfer Büros der FES, der Konrad-Adenauer Stiftung und der WHO zur Sprache. Er verschärft Gesundheitsprobleme und befördert Migration, die wiederum Wechselwirkungen bis hin zu sozialen Spannungen in den Aufnahmegesellschaften zur Folge hat. Zugleich wurde ebenso deutlich, dass die Versicherheitlichung der Migrationsdebatte übersieht, dass Menschen sowohl Schutz vor Verfolgung brauchen als auch selbst zur durch Integration und gesellschaftliches Engagement zur Sicherheit einer Gemeinwesens beitragen. Auch der Globale Migrationspakt lässt sich so unter dem Vorzeichen integrierter Sicherheit betrachten: Er verbindet Menschenrechte, Entwicklung sowie Sicherheit und stellt den Menschen in den Mittelpunkt.
Die Genf-Exkursion bestätigte somit die Aktualität des AKJS-Jahresthemas „Strategisches Denken als Ausdruck Integrierter Sicherheit“. Von WHO-Pandemievorsorge über Schweizer Neutralität bis Multilateralismus: Effektive Sicherheitspolitik erfordert strategisches Denken, das traditionelle Silos überwindet und verschiedene Instrumente koordiniert. Zudem muss sie heute als umfassendes Risikomanagement verstanden werden, das Gesundheit, Umwelt, Technologie, Wirtschaft und klassische Sicherheitsfragen strategisch verzahnt. Zentral dabei: Menschen sind sowohl Empfänger als auch Sender von Sicherheit.
Autorin: Tina Behnke
