Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD 2025 setzt mehrere Impulse für strategische Vorausschau im Regierungshandeln. Sebastian Bollien vom Foresight-Kompetenzzentrum der BAKS ordnet sie in die Entwicklung der Regierungsvorausschau in Deutschland ein.

Bundeskanzler Friedrich Merz und das Bundeskabinett nach der Vereidigung am 6. Mai: Wenn die Bundesregierung es schafft, Vorausschau einzusetzen, um gemeinsame Lagebilder, Zielvorstellungen und Strategien zu entwickeln, könne das nicht nur ein besseres Verständnis für sicherheitspolitische Lageeinschätzungen hervorrufen, sondern auch Vertrauen in damit verknüpfte, teils unbequemere Maßnahmen, schreibt Sebastian Bollien. Foto: Deutscher Bundestag / Thomas Imo / phototek
Prolog
Strategische Vorausschau verbindet. Durch das gemeinsame und systematische Nachdenken über Zukünfte erschaffen wir diese nicht nur in unserem Geist, sondern können sie bereits in der Gegenwart gemäß unseren Zielvorstellungen strategisch beeinflussen. Die Regierungskoalition aus Union und SPD möchte „Verantwortung für Deutschland“ übernehmen, so die Überschrift ihres Koalitionsvertrags, und damit für eine gemeinsame Zukunft in Frieden, Freiheit und Sicherheit. Das Dokument gibt sich den Anspruch, Zukunft zu gestalten, und setzt dazu auch konkrete Impulse für die Nutzung von strategischer Vorausschau im Einklang mit einer integrierten Sicherheitspolitik und greift wissenschaftliche Handlungsempfehlungen hierzu auf. Grund genug, sich diese zu erwartende Evolution der Regierungsvorausschau in Deutschland ein wenig genauer anzuschauen.
Erster Akt – Bestandsaufnahme
Die Methoden der strategischen Vorausschau und Ansätze der Zukunftsforschung in einer Regierung und bei deren Beratung anzuwenden, ist nicht neu. Viele Methoden, zum Beispiel im Feld der Szenarioanalyse, lassen sich in westlichen Demokratien bis in die 1940er Jahre zurückverfolgen. Seit den 1990er Jahren – Zeiten großer Transformation in Deutschland – halten sie zunehmend Einzug in die deutsche Regierungslandschaft, insbesondere im Bildungs- und Forschungsbereich, beim Militär, in der Außenpolitik oder im Umweltressort. Die nach der Bundestagswahl 2013 gebildete schwarzrote Koalition verankerte den Begriff der strategischen Vorausschau im damaligen Koalitionsvertrag, woraufhin in den Ministerien Kapazitäten dafür aufgebaut wurden. Im Jahr 2022 gab es eine erste umfassende Bestandsaufnahme durch das Fraunhofer Institut für Systemforschung und Innovation in Form einer Studie zur Institutionalisierung von Strategischer Vorausschau als Prozess und Methode in der Bundesregierung.
Die Studie beschreibt detailliert die Entwicklung strategischer Vorausschau in Regierungsnähe und erkennt viel Fortschritt, stellt jedoch auch fest, dass es bis dato an ressortübergreifender Zusammenarbeit und an einem Dialog zwischen Regierung, Parlament und Öffentlichkeit mangele. Dabei betont sie die Bedeutung von Regierungsvorausschau im internationalen Vergleich sowie die Rolle von Vorausschau für den Ausbau von Resilienz und für die gesamtgesellschaftliche Legitimation von Transformationsprozessen, wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder Urbanisierung.
Seit dieser Studie sind knapp drei Jahre vergangen. In den verschiedenen Ressorts wurden Vorausschaufähigkeiten punktuell verbessert, allerdings ohne den großen Durchbruch zu erzielen. Regelmäßig lädt auch das Bundeskanzleramt zum Ressortkreis Strategische Vorausschau, um das Thema in seiner Relevanz sichtbar zu halten. Das Methodenseminar Strategische Vorausschau an der BAKS wird von den Ressorts durchweg stark nachgefragt, und die Diskussionen mit den Teilnehmenden zeigen, wie wichtig Methodenkenntnis und -anwendung als auch die Förderung ressortgemeinsamen Denkens weiterhin sind.

Das Bundeskanzleramt lädt regelmäßig zum Ressortkreis Strategische Vorausschau.
Foto: Wikimedia Commons/Tischbeinahe/CC BY 3.0
Zweiter Akt – Integrierte Sicherheit
„Die Bundesregierung setzt sich für eine verstärkte Nutzung wissenschaftsbasierter Ansätze für Krisenfrüherkennung, strategische Vorausschau, Krisenprävention, Stabilisierung und Friedenssicherung ein“, heißt es in der ersten Nationalen Sicherheitsstrategie Deutschlands von Juni 2023. Neben der Wehrhaftigkeit als erste Säule gegen äußere Bedrohungen ging es der Bundesregierung in der Strategie vor allem um Resilienz und Nachhaltigkeit – und damit um Felder, in denen strategische Vorausschau schon regelmäßig mitgedacht wird.
Resilienz bedarf einer gemeinsamen Identifikation von Werten und Zielvorstellungen, also einer gemeinsamen Zukunftsvision, die es heute schon zu verteidigen gilt. Nachhaltigkeit, im Sinne der Sicherung unserer Lebensgrundlagen, muss global gedacht werden und steckt voller Trends und Megatrends, die in teils unerforschten Wechselwirkungen zueinanderstehen oder Disruptionen hervorrufen können, die aktuellen Erwartungen entgegenstehen. Gute Beispiele hierfür finden sich im Foresight-Report der EU von 2022 und im Toolkit for Resilient Public Policy der OECD von 2025, darunter etwa ungeahnte Hitzewellen, Durchbrüche in der Biotechnologie oder das unerwartete Ende grüner Technologien.
Sich im hektischen Regierungsgeschäft bei diesen Transformationen nicht treiben zu lassen, sondern zum Treiber zu werden, hänge maßgeblich vom Zusammenspiel von Prognose (Forecast) und Vorausschau (Foresight) ab, schreibt Cilia Ebert-Libeskind in einem Sammelband des Bundeskanzleramts mit dem Titel "Zwischen Zumutung und Zuversicht".
Die neue schwarzrote Koalition muss das Rad nicht neu erfinden. Sie startet in einer Phase, in der seitens Verwaltung, Politik und Beratung das Verständnis für proaktive, ressortübergreifende und gesamtgesellschaftliche Zukunftsgestaltung wächst und mit ihr die Nachfrage nach Vorausschaumethoden im Regierungsumfeld steigt. Nicht zuletzt ist es für das Erreichen der sicherheitspolitischen Ziele der Bundesregierung zentral, Transformationspfade und Einflussmöglichkeiten fremder Akteure, neuer Technologien sowie möglicher neuer geopolitischer Ordnungen und neuer Allianzen vorausschauend mitzudenken – auch und gerade die unbequemen.
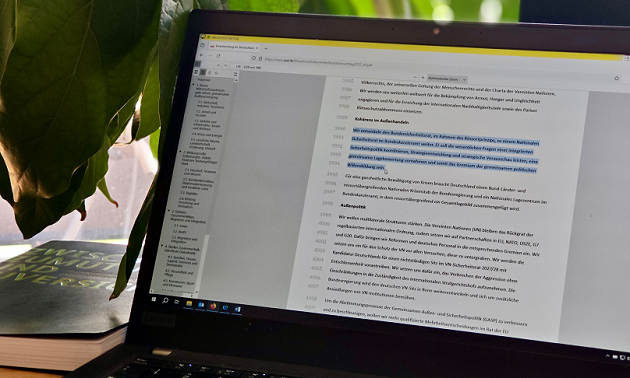
Was sagt der Koalitionsvertrag 2025 zur Strategischen Vorausschau? Foto: Sebastian Bollien
Dritter Akt – Vorausschau im Koalitionsvertrag
Jede neue Regierung startet mit dem Wunsch, die Zukunft aktiv mitzugestalten. In der Vergangenheit wurden solche Intentionen jedoch oft durch externe Krisen ausgebremst, wodurch letztlich mehr reagiert als agiert wurde. Zudem bringt jedes Regierungsbündnis seine eigenen Schwerpunkte mit. So kam im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung 2021 das Wort „nachhaltig“ über 50-mal vor. Der nun vorliegende Koalitionsvertrag von Union und SPD für die 21. Legislaturperiode, bei ähnlichem Umfang, verwendet den Begriff nur 12-mal. Der Begriff "Zukunft" tauchte 2021 noch 72-mal auf – nun nur noch 17-mal. Und doch fügt sich der neue Vertrag nahtlos in die Evolution integrierter Sicherheit und Regierungsvorausschau ein, nicht zuletzt weil strategische Vorausschau nun explizit und an entscheidenden Stellen genannt wird.
So soll strategische Vorausschau ein Grundpfeiler für ein digital souveränes Deutschland werden (Zeile 2171ff.) und helfen, Trends und Treiber als Anlass für die Ausbildung möglichst gesamtgesellschaftlicher digitaler Kompetenzen und Resilienz zu verstehen. Damit einhergehen soll eine digitale Verwaltung und die Teilhabe an zukünftigen Schlüsseltechnologien.
Ein nationaler Sicherheitsrat als Weiterentwicklung des Bundessicherheitsrates soll die wesentlichen Fragen integrierter Sicherheitspolitik koordinieren und auch mit Hilfe von strategischer Vorausschau das Zentrum für eine gemeinsame Lagebewertung und Strategieentwicklung über die Ressortgrenzen hinweg werden (Zeile 3989ff.). Das Vorhaben kann darin unterstützen, die Ziele der nationalen Sicherheitsstrategie zu erreichen oder ein mögliches Update der Strategie effizienter umzusetzen. Ebenso kann Vorausschau dabei helfen, weitere konzeptionelle Vorhaben wie die Cybersicherheitsstrategie (Zeile 2676ff.) und die geplante Weltraumsicherheitsstrategie (Zeile 4166ff.) von Anfang an ganzheitlich zu denken und zukunftsrobuster zu gestalten. Allerdings bieten die Formulierungen zur tatsächlichen Ausgestaltung von institutioneller Vorausschau aufgrund der eher allgemein gehaltenen Aussagen weiterhin viel Interpretationsspielraum. Auch überrascht, dass der Organisationserlass der neuen Bundesregierung vorsieht, Strategische Vorausschau aus dem Bundeskanzleramt ins neu gebildete Digitalministerium umzuziehen, was den Plänen im Koalitionsvertrag teilweise entgegenstünde.
Nicht zuletzt zeigt das Vorhaben Nationaler Sicherheitsrat aber, dass bestehende Defizite, wie sie insbesondere in der Fraunhofer-Studie angesprochen werden, erkannt wurden. „Strategische Vorausschau wirksam zu verankern“ (Zeile 2179ff.) bedeutet, Silodenken innerhalb der Ressorts aufzubrechen und sich in Richtung eines „Whole-of-Government“-Ansatzes für die strategische Ausrichtung der Regierung zu bewegen.
Epilog
Mit expliziten Erwähnungen im Koalitionsvertrag und damit verbundenen konkreten Vorhaben wird die strategische Vorausschau im Regierungskontext sichtbarer. Sie setzt damit erkennbar auf eine Evolution auf. Auch wenn „Zukunft“ weniger oft erwähnt wird als im vorherigen Koalitionsvertrag liest sich die aktuelle Vereinbarung deutlich vorausschauorientierter. Wenn die neue Bundesregierung es schafft, Vorausschau einzusetzen, um gemeinsame Lagebilder, Zielvorstellungen und Strategien zu entwickeln, kann dies nicht nur ein besseres Verständnis für sicherheitspolitische Lageeinschätzungen hervorrufen, sondern auch Vertrauen in damit verknüpfte, teils unbequemere Maßnahmen.
Krisen und externe Schocks lassen sich dadurch nicht vermeiden, aber ein ressortgemeinsamer – integrierter – Ansatz auch für eine gemeinsame Zukunftsbetrachtung würde die Bundesrepublik befähigen, gesamtgesellschaftlich schneller wieder aus dem Reagieren ins Agieren zu kommen. Politik und Wissenschaft können so in die Lage versetzt werden, Strategien und alle damit verbundenen Maßnahmenauf eine breite gesellschaftliche Akzeptanz zu stützen. Nicht zuletzt sollte eine gemeinsame Vorausschau aber auch positive, wünschenswerte und breit akzeptierte Zukünfte miterschaffen und sie für möglichst viele Menschen auch vorstellbar und erreichbar erscheinen lassen.
Autor: Sebastian Bollien
Der Autor gibt seine persönliche Meinung wieder.
